Vertrauenswürdige Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme
Forschungsplattform im TEN.efzn
Was Digitalisierung mit der Energiewende zu tun hat? Eine ganze Menge. Davon sind die Wissenschaftler:innen der TEN.efzn-Forschungsplattform Vertrauenswürdige Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme überzeugt.
„Energiewende in Deutschland, das ist ein Riesenthema“, sagt Koordinator Dr.-Ing. Sven Rosinger: „Und ganz viele Facetten dieses Themas betrifft die Digitalisierung.“ Sie sei bereits mitten in der Gesellschaft angekommen. Und gehe deshalb jeden Menschen an – nicht nur Forschende, Fachleute und Technikbegeisterte.


Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Lehnhoff vom Sprecher:innenteam der Forschungsplattform führt dazu aus: „Digitalisierung ist das Rückgrat vieler Innovationen im Energiesystem. Sie ermöglicht nicht nur die Integration neuer, effizienterer Technologien in bestehende Netze, sondern auch deren intelligente Steuerung und Überwachung. Gleichzeitig schafft sie die Grundlage für die aktive Einbindung der Nutzer:innen – also jener Menschen, die diese Technologien besitzen, anwenden und damit die Energiewende vor Ort mitgestalten.“
Photovoltaik, Wärmepumpe und Co: Energiewende und die Technik
Denn: Die PV-Anlage auf dem Dach, die Steckersolar-Anlage auf den Balkon, sie sind längst keine Exoten mehr. Sondern gehören wie Wärmepumpen ganz selbstverständlich zum Bild in Städten und Dörfern. Wallboxen in der Garage oder unter dem Carport stellen sicher, dass das E-Auto bequem zuhause geladen werden kann – optimalerweise mit selbsterzeugtem Strom. Und um den selbst bestmöglich nutzen zu können, gibt es vielleicht auch bereits einen privaten Stromspeicher.
Wer in seine private Anlagentechnik so viel Planung und Geld investiert hat, will sie natürlich möglichst effektiv und profitabel betreiben. Erzeugung und Verbrauch sollen deshalb bestmöglich aufeinander abgestimmt sein, und zwar rund um die Uhr. Eine komplexe und potenziell tagesfüllende Aufgabe, die zahlreiche Faktoren berücksichtigen muss.
Einspeisen oder selbst verbrauchen? Wie wird das Wetter morgen, wieviel Ertrag kann ich von meiner Anlage erwarten? Reicht der für meinen Bedarf auch aus? Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Waschmaschine anzustellen, das Auto zu laden, den Batteriespeicher zu füllen? Wann ist Strom, den ich doch zusätzlich aus dem Netz beziehen muss, am günstigsten?
Dynamische Stromtarife und dynamische Netzentgelte sorgen für viel Flexibilität, sind aber bei viertelstündlich wechselnden Kursen auch schwieriger im Blick zu behalten. Von kommenden möglichen regulatorischen Anpassungen, etwa im Bereich Energy Sharing einmal ganz abgesehen.
Selbst für Menschen, die tief in der Materie stecken, bedeutet es großen Aufwand, all diese Faktoren ständig im Blick zu behalten. Auch wenn sich manches durchaus mittels bewusster Verhaltensweisen steuern ließe: Durchschnittsbürger:innen dürften Unterstützung benötigen.
Digitalisierung schafft die Grundlage für die aktive Einbindung der Nutzer:innen – also jener Menschen, die diese Technologien besitzen, anwenden und damit die Energiewende vor Ort mitgestalten
Digitales Energiemanagement sorgt für Transparenz und Effektivität im System
Hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Denn die macht es möglich, all die Geräte, die Energie erzeugen und verbrauchen, miteinander in Einklang zu bringen. Mittels eines vertrauenswürdigen, selbstorganisierenden Energiemanagementsystems. Einen Prototyp einer solchen Energiemanagement-Plattform zu entwickeln – und zwar einer, die nicht nur in einem einzelnen Haushalt einsetzbar ist, sondern auch in Quartieren und weit darüber hinaus–, ist das Ziel der Forschungsplattform Vertrauenswürdigen Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme. Der Weg dahin ist ebenso innovativ wie interdisziplinär: Technisch-naturwissenschaftliche Energieforschung verschränkt sich hier mit sozialwissenschaftlicher Transformationsforschung.
Ein solches Energiemanagementsystem enthält viele digitale Agenten. Jede dieser speziellen Softwareanwendungen überwacht nur einen kleinen Teil des Systems: Der eine Agent überwacht die PV-Anlage und bezieht dabei etwa externe Daten wie Wetterprognosen ein. Der Nächste ist für den Betrieb der Wärmepumpe zuständig und steuert diese mit Blick auf den Wärmebedarf des Hauses, und so weiter. Jeder dieser Agenten betrachtet nur seinen speziellen Bereich, hat eigene Interessen. Das kann innerhalb des Systems durchaus für Konfliktpotential sorgen.
Ein digitales Energiemanagement hat deshalb nicht nur die Aufgabe, die Kommunikation zwischen den einzelnen Agenten zu ermöglichen. Es soll auch dafür sorgen, dass diese gemeinsam möglichst optimale Entscheidungen treffen für den Inhabenden des Systems. Und: Diese Entscheidungen sollen transparent, hinterfragbar und nachvollziehbar sein. Es geht also auch ganz konkret um Vertrauen. Ohne das ist eine Abgabe der Hoheit über die einzelnen Entscheidungen an eine automatisierte Technik nämlich schlichtweg nicht denkbar.
„Software-Agenten sind in der Lage, nicht nur die Automatisierung dieser Prozesse umzusetzen, sondern sogar individuelle Wünsche und sogar Wertvorstellungen von Privatpersonen abzubilden“, sagt Co-Sprecherin Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße: „Für das Thema Vertrauen stellen sie daher einen echten Game Changer dar: Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich in einem automatisierten Energiemanagement mit allen meinen Vorstellungen repräsentiert werde, lasse ich das System machen – und erlaube es damit auch, ganz neue Flexibilitätspotentiale in Quartieren zu heben.“
Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich in einem automatisierten Energiemanagement mit allen meinen Vorstellungen repräsentiert werde, lasse ich das System machen – und erlaube es damit auch, ganz neue Flexibilitätspotentiale in Quartieren zu heben.

Vertrauen in die Digitalisierung ist die Basis für die Energiewende
Vertrauen, das ist also eine der grundlegenden Voraussetzungen für ein Gelingen der Energiewende, sind die Forschenden überzeugt. Und das Vertrauen in die Digitalisierung spielt dabei eine höchst wichtige Rolle. Insbesondere da, wo ihre Bedeutung über den einzelnen Haushalt hinausgeht: im Quartier und auch weit darüber hinaus. Das Stichwort ist Netzdienlichkeit.
Während es im Mikrokosmos eines einzelnen Haushaltes vornehmlich um eine Abwägung geht, die sowohl möglichst gut für die Umwelt und den eigenen ökologischen Fußabdruck ist als auch für das eigene Portemonnaie, muss ein Stromnetz gleichzeitig möglichst stabil, zuverlässig und effizient sein für alle Beteiligten. Und zwar auch dann, wenn zahlreiche Verbrauchende gleichzeitig Strom benötigen oder einspeisen wollen.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist etwa die PV-Erzeugung in der Mittagszeit. Wer einen Speicher hat, betreibt diesen üblicherweise und nachvollziehbar wie folgt: Wenn der Speicher nicht voll ist, aber gerade Strom produziert wird, der nicht sofort verbraucht werden kann, wird der Speicher geladen. Das aber führt zu massiven Problemen bei Netzbetreibern. Denn wenn um 11 Uhr vormittags in Deutschland alle Speicher voll sind, drückt der Überschuss aller Anlagen gleichzeitig ins Netz – und die Netzbetreiber wissen nicht mehr, wohin damit.
Dabei wäre alles überhaupt kein Problem, wenn diese Speicherbetriebsstrategie zeitlich versetzt wäre. Wenn also der Überschuss morgens noch ins Netz eingespeist und der Speicher erst ab 10 oder 11 Uhr geladen würde. Das aber kollidiert mit dem Interesse des Einzelnen: Es könnte ja mittags ein Regenschauer kommen, der verhindert, dass der eigene Speicher an diesem Tag vollgeladen wird.
Intelligente Systeme treffen Entscheidungen automatisiert
Was auf kleiner Ebene sinnvoll ist, muss also nicht gut sein für das große Ganze. Im Gegenteil. Die Aufgabe eines Energiemanagementsystems ist es, hier eine möglichst für alle gute Entscheidung zu treffen. Das kann dann eben auch bedeuten, dass ein Agent mit Blick auf das Wohl der Allgemeinheit die Entscheidung trifft, an einem sonnigen Tag eben nicht bereits morgens um 9 Uhr damit zu beginnen, den eigenen Speicher zu laden.
Eine vom Energiemanagementsystem getroffene Entscheidung für die Netzdienlichkeit kann für den Einzelnen also durchaus anders ausfallen, als er oder sie es gerne hätte. Umso wichtiger sind gerade bei solchen Entscheidungen Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Denn nur wenn diese Faktoren gegeben sind, sind Menschen auch bereit, diese Digitalisierung als eine wirklich vertrauenswürdige zu akzeptieren. Und das ist wiederum eine Voraussetzung dafür, dass sie selbst aktiv in die Energiewende einsteigen. Etwa ganz konkret, indem sie in entsprechende Technologien investieren.
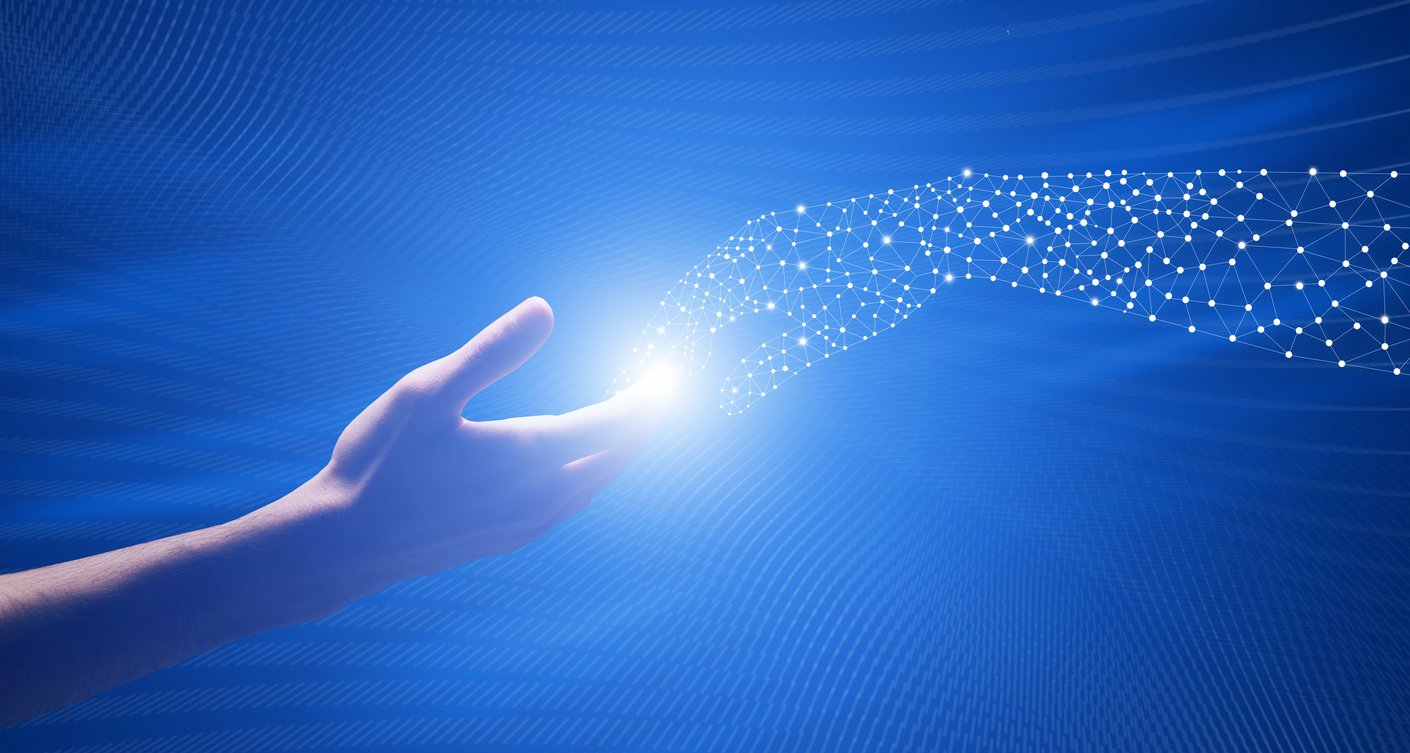
Was ist Vertrauen? Forschen aus interdisziplinärer Perspektive
Neben vertrauenswürdiger Digitalisierung braucht es also vor allem Vertrauen in die Digitalisierung. Doch wie lässt sich dieses erreichen? Was macht das Vertrauen aus? Gibt es messbare Parameter dafür? Kennzahlen, die sich in ein intelligentes automatisiertes Energiemanagementsystem einspeisen lassen? Wie lassen sich diese Parameter bereits im Entwicklungsprozess eines solchen Systems berücksichtigen, das mit fortschreitender Energiewende deutlich höheren Ansprüchen genügen muss als bisherige Vorgänger?
Diese Fragen gehen über ein rein technisches Verständnis von Vertrauen in Form von Zuverlässigkeit, Beobachtbarkeit, Verfügbarkeit und Erklärbarkeit weit hinaus. Es gilt nämlich gleichzeitig, auch Fragen von Akzeptanz, Motivation, Vorbehalten und ähnlichem zu klären; herauszufinden, welche sozialen Dynamiken entstehen, wie sie sich auswirken und wie sich auch dezentrale Akteure optimal integrieren lassen. Das aber sind ganz klar sozialwissenschaftliche Fragestellungen.
Um technisches und soziales Vertrauen in einem Trust-Modell zusammenzuführen, das die Grundlage für die Entwicklung des zu entwickelnden vertrauenswürdigen, selbstorganisierenden Energiemanagementsystems bildet, wird deshalb interdisziplinär geforscht. Dieser Ansatz mit Blick über den eigenen fachlich hochspezialisierten und ebenso kompetenten Tellerrand zeichnet übrigens das gesamte Forschungsprogramm TEN.efzn aus. Auch betriebswirtschaftliche und juristische Aspekte werden in dieser speziellen Forschungsplattform neben technischen, soziologischen und psychologischen Fragestellungen in den Blick genommen.
Das ist Sebastian Lehnhoff zufolge unverzichtbar: „Gerade die enge Verzahnung verschiedener Disziplinen ist für uns essenziell – nur wenn Technik, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht gemeinsam gedacht werden, können wir ein Vertrauensmodell entwickeln, das tatsächlich tragfähig ist. Unser Ziel ist es, daraus nicht nur theoretische Erkenntnisse abzuleiten, sondern ein Fundament zu schaffen, auf dem sich technische Betriebskonzepte und digitale Energiemanagementsysteme der Zukunft aufbauen lassen. Diese systemische Herangehensweise ist bislang einzigartig in der Energieforschung und eröffnet völlig neue Perspektiven.“
Gerade die enge Verzahnung verschiedener Disziplinen ist für uns essenziell – nur wenn Technik, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht gemeinsam gedacht werden, können wir ein Vertrauensmodell entwickeln, das tatsächlich tragfähig ist.
Der Ansatz: Menschen im Quartier mitnehmen bei der Entwicklung – von Anfang an
Um auf der Suche nach sozialen Vertrauensbedingungen ganz nah an Bürgerinnen und Bürgern zu sein und mit diesen ins Gespräch zu kommen, gehen die beteiligten Sozialwissenschaftler:innen in ein echtes Wohnquartier. Feldforschung trifft dabei auf Partizipation. Die Menschen mitnehmen, von Anfang an mit Kampagnen und Veranstaltungen vor Ort in die Entwicklung einbeziehen, ist das Ziel.
Das ist gleichermaßen unüblich wie erfolgsversprechend. Denn: Vertrauen lässt sich nicht schaffen. Vertrauen stellt sich ein. Letztlich lassen sich zwar Rahmenbedingungen und Transparenz schaffen, aber Vertrauen muss sich intrinsisch herausbilden.
Neben dem in Erfahrung bringen von Dynamiken zwischen Akteuren in einem Energiesystem in einem Quartier, neben dem Eruieren der Bedürfnisse von Mieterinnen und Mietern, Wohnbaugesellschaften und Energiegesellschaften geht es also auch ganz konkret darum, digitale Prozesse der Energiewende durchsichtig zu machen. Und so Raum für Vertrauen zu schaffen.

Das Reallabor Helleheide: ein Ort für sozialwissenschaftliche Analysen
Der Raum, in dem dies vonstattengeht, ist auch geographisch ein ganz besonderer: das Quartier Helleheide. Dieses befindet sich auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg und gehört zu dem von der Stadt erworbenen Gelände, auf dem ein neuer Stadtteil entsteht.
Im Zuge eines Forschungsprojektes wurde das Quartier Helleheide bewusst als ein Reallabor entwickelt, in dem weitere Projekte initiiert, umgesetzt und so unter möglichst großer Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner Forschungsergebnisse erprobt werden können. Ideale Voraussetzungen also, auf die die TEN.efzn-Forschungsplattform Vertrauenswürdigen Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme für die geplante soziologische Feldforschung zurückgreifen kann.
Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg entsteht auf von der Stadt erworbenen Gelände ein neuer Stadtteil. Mehrere Baugebiete auf dem ehemaligen Militärgelände sollen bis zu 3000 Menschen ein neues Zuhause bieten.
Eines dieser Baugebiete ist das Quartier Helleheide. Für dieses wurde mit dem Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg (ENaQ), unter maßgeblicher Beteiligung von OFFIS – Institut für Informatik von 2018 bis 2023 ein klimafreundliches und zukunftsweisendes Energiekonzept entwickelt:
https://www.enaq-fliegerhorst.de/
Der Energiebedarf soll zum größten Teil aus lokal erzeugter Energie gedeckt werden. Beim Aufbau des Versorgungsnetzes wurde von Beginn an eine Kopplung von Strom, Wärme und Mobilität vorgesehen. Die Energieeffizienz wird durch Umwandlung überschüssiger Energie in andere Energieformen, Speichern oder direktes Bereitstellen der Energie für benachbarte Verbraucher:innen deutlich gesteigert. Teil des ENaQ-Ansatzes war nicht nur, ein auf andere Quartiere übertragbares Modell zu schaffen. Sondern dieses auch künftig als ein für die Forschung nutzbares Reallabor zu installieren.
Da die aber auch ihre Grenzen hat, arbeiten die Forschenden parallel in spezialisierten Laboren ihrer Projektpartner mit Simulationen. Schließlich können die Forschenden nicht im laufenden Betrieb in das Quartier eingreifen und die Leute zwingen, sich anders zu verhalten, um zu sehen, wie sich das auf das Netz und auf das gesamte Energiesystem auswirkt. Dazu dienen dann jene Simulationen und Labortests, die zum Teil extra für das TEN.efzn-Projekt aufgerüstet werden.
„Die erhobenen Daten aus dem Feld werden uns unterstützen, auch in Simulationen eine bessere Abbildung der Wirklichkeit zu erreichen – dabei unterstützen wir diese Prozesse mit einem guten Forschungsdatenmanagement von Beginn an“, macht Astrid Nieße klar.
„Unsere große Hoffnung ist, dass wir mit dieser Forschungsplattform nicht nur fundierte Erkenntnisse über die Voraussetzungen und Mechanismen zur Vertrauensbildung in Energiesystem gewinnen, sondern auch konkrete Ansätze für deren Umsetzung entwickeln“, sagt Sebastian Lehnhoff: „Uns geht es darum, wissenschaftliche Konzepte so zu gestalten, dass sie in technische Anwendungen, gesellschaftliche Prozesse und wirtschaftliche Modelle überführt werden können – im Energiemanagement, in Betriebskonzepten und letztlich im Alltag der Menschen.“
Die erhobenen Daten aus dem Feld werden uns unterstützen, auch in Simulationen eine bessere Abbildung der Wirklichkeit zu erreichen – dabei unterstützen wir diese Prozesse mit einem guten Forschungsdatenmanagement von Beginn an.



